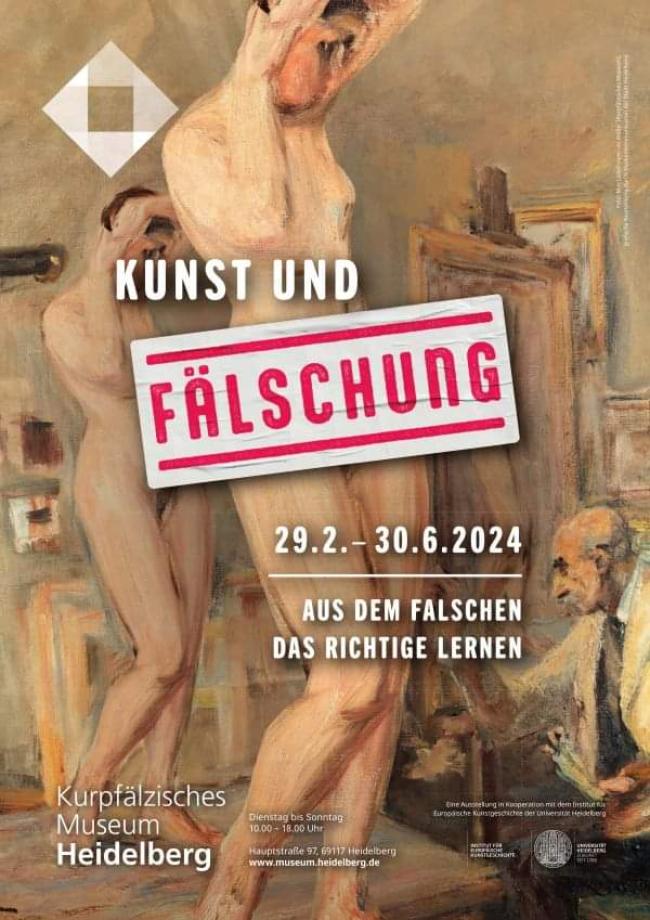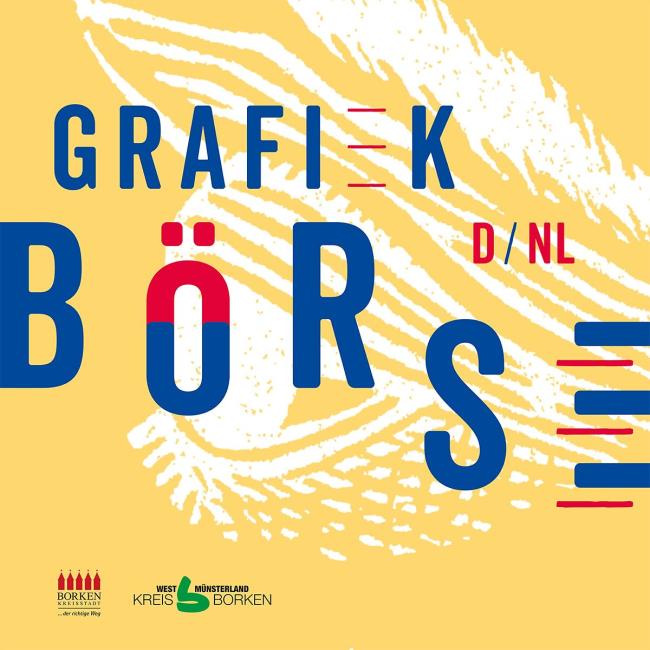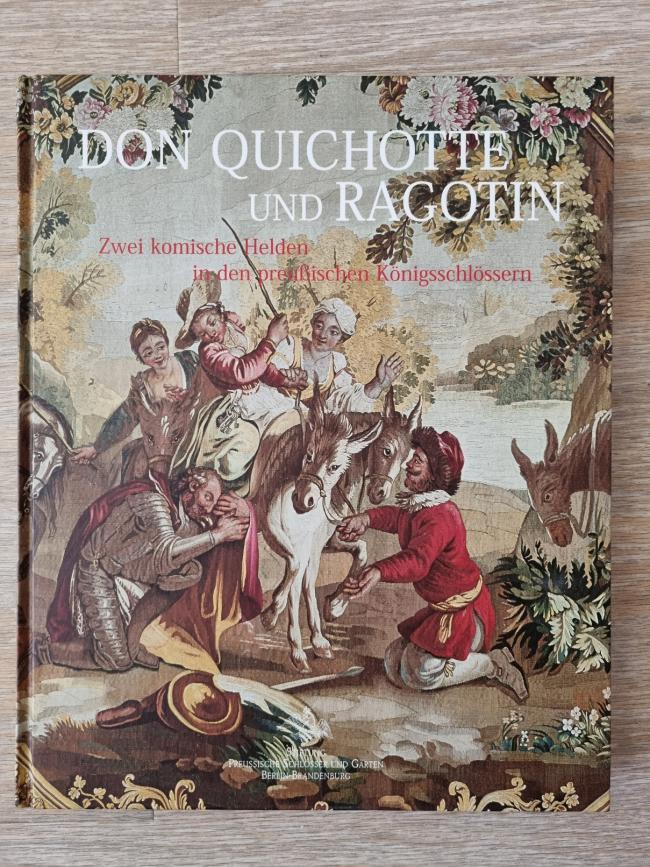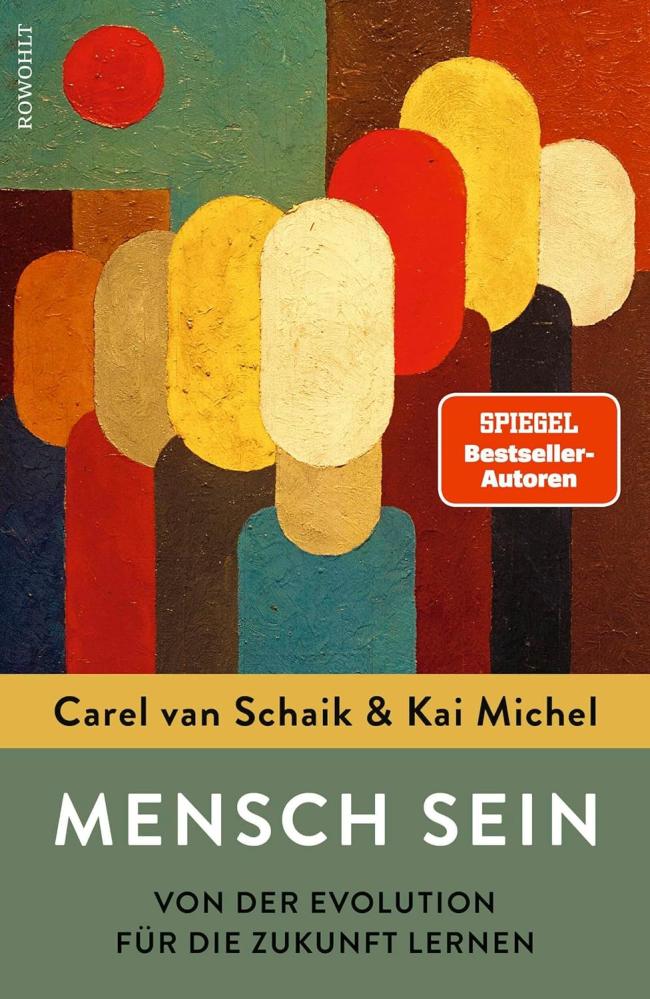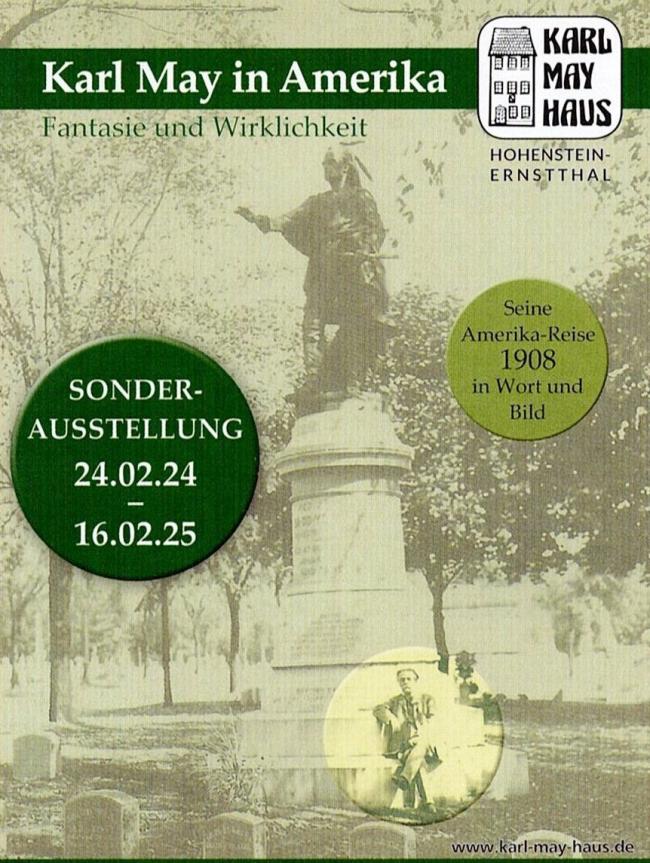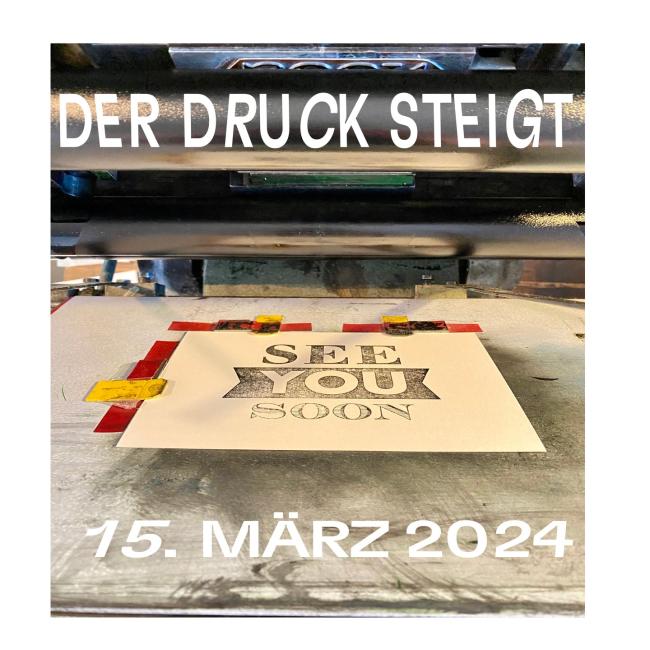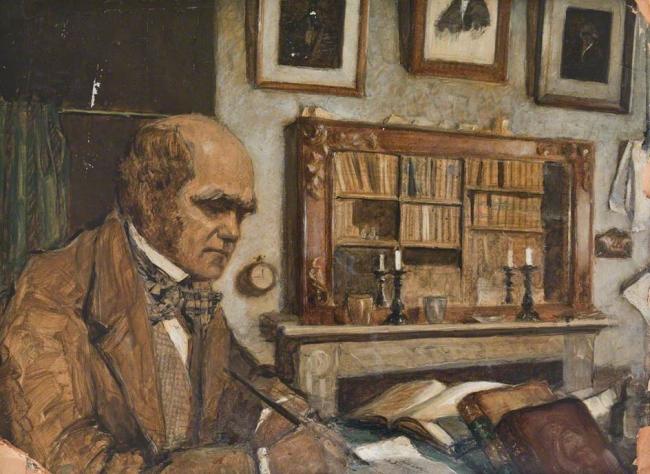Geht das überhaupt zusammen: Schöne Gedichte, geschrieben von einem Völkischen, den man mit einigem Recht auch Nazi nennen könnte? Ja, es geht. Was schon bei Gottfried Benn und Martin Heidegger zu studieren war, es trifft auch auf Herbert Sailer (1912–1945) zu: Ästhetik, Kunstsinn, Lyrik, Philosophie und Barbarei schließen sich nicht immer aus. Auch ein so großartiger Dichter wie Johannes R. Becher hat eine Danksagung an Stalin verfasst, vor dessen Regime er gezittert hatte.
Es ist ein mutiges Unterfangen des Schriftstellers Till Sailer, des Sohnes von Herbert Sailer, sich des lyrischen Erbes und des Lebens seines Vaters anzunehmen und eine „Annäherung“ zu schreiben. Ja, Annäherung, sagt der Untertitel des Buches Der Krieg meines Vaters. Wie anders auch soll der Umgang mit den nun schon sehr fernen Leben der Mütter und Väter unserer Generation – also der während des Krieges und der kurz danach Geborenen geschehen? Besserwisserei und das Nichts-damit-zu tun-haben-Wollen, wie ich es von mir kenne, erwiesen und erweisen sich als unnütz.
Diese Worte trafen mich, beschreiben sie doch haargenau meine Empfindungen gegenüber meinem Vater, dem ich zugetan war, der aber auch fern blieb mit seinem Leben im Zweiten Weltkrieg und den Jahren sibirischer Gefangenschaft. Und der bis auf ein paar „Anekdoten“ schwieg … Und wie ergeht es einem, wenn man auf eine dichterische Hinterlassenschaft trifft, wie man sie bei Herbert Sailer finden kann, eine gehaltvolle, tiefgründige und innige Lyrik? „Ich weiß, du liegst jetzt ganz allein / und keiner kommt und deckt dich zu. / Du möchtest nichts als müde sein / und keiner kommt und deckt dich zu. / Du liegst, vom Sturz der Tränen blind / und keiner kommt und deckt dich zu. / Und frierend horchst du in den Wind / und keiner kommt und deckt dich zu.“ Und gleich darauf vielleicht das Blatt mit: „Die feste Stirne helmbewehrt, / der Brauen Bogen ohne Fehl, / das Aug’, hell in den Tag gewandt, / grau wie der Waffe blanker Stahl …“ Und – mit solchem Trara ist das völkische Kitschgefäß Herbert Sailers noch lange nicht ausgeschöpft.
Es ist ein solcher Widerspruch nicht zu lösen. Till Sailer geht den die Distanz ermöglichenden Weg, dass er diesen Mann, seinen ihm fast unbekannt gebliebenen Vater betrachtet als jemanden, „der mir wie eine literarische Figur erscheint.“ So gelingt es ihm, das wahrlich nicht unkomplizierte Leben Herbert Sailers zu erzählen, eines Erziehungswissenschaftlers, NSDAP-Mitglieds und Reichsjugendführung-Funktionärs, des Lehrers an nationalsozialistischen Eliteschulen, Soldaten, Verwundeten, eines „Volkssturm-Mannes“, der immer Dichter war und es blieb bis zu seinem frühen Ende am 13. April 1945. Noch im März hatte er sich in einem Gedicht gefragt, wie viele Tage noch das „Licht kündet“. Eine Zeile weiter verrennt er sich in das Hirngespinst, das damals wohl viele teilten, nämlich die ganze Erde habe sich „wider uns verbündet“. Und was bleibt? Die „Pflicht“! In anderen Gedichten sieht er das Elend, die Sinnlosigkeit des Krieges sehr genau.
Mehrmals kommt in den Gedichten Herbert Sailers die Ukraine vor, das Land, in dem der Krieg schon wieder grausige und nahe Wirklichkeit ist. Gewiss hat auch diese schlimme Aktualität Till Sailer bewogen, die Texte seines Vaters öffentlich und zugänglich zu machen. Und so sehr man dem Autor darin folgen kann, diesen Herbert Sailer, seinen Vater, als literarische Figur zu betrachten, um überhaupt mit ihm „umgehen“ zu können, so tritt dieser mit dem Wort Ukraine doch in eine beklemmende Realität, denn so sparsam die Mitteilungen meines Vaters aus seiner Vergangenheit auch waren: Dieses Wort kam vor. Er sprach es, wie viele seiner Generation Ukreine aus. Das schon etwas ermüdete Wort, dass die Vergangenheit noch nicht einmal vergangen sei, es ist doch wahr!
Dieses mutige Buch Till Sailers bietet die seltene Gelegenheit, in die Gedanken-, Gefühls- und Vorstellungswelt einer nur scheinbar fernen Zeit zu gelangen. Es antwortet auf Fragen, die vielleicht nie gestellt wurden, oder die keine Antwort fanden. Es zeigt, dass Kunstsinn, Intelligenz, Sensibilität und Kriegsbrutalität sehr nahe Nachbarn sein können. Es stellt auch die Frage, wie stark unsere „Kulturhaut“ ist in Zeiten, da wieder von „Kriegstüchtigkeit“ geredet wird. Und darum ist diese „Annäherung“ bitter nötig. (Till Sailer: Der Krieg meines Vaters. Eine Annäherung. Halle an der Saale: Mitteldeutscher Verlag 2023. Broschiert, 308 S., ISBN 978-3-96311-815-9, 20 Euro.)
(Albrecht Franke)